Projekt zur Aufarbeitung behördlicher Gräueltaten während der NS-Diktatur
Sich mit der eigenen Verantwortung während der NS-Diktatur auseinandersetzen, die Schuld daran anerkennen und sich angemessen für das Geschehene entschuldigen: Mit der Zielsetzung, behördliche Gräueltaten während der NS-Diktatur in Hagen aufzuarbeiten, hat die Caritas eine Projektförderung bei „Aktion Mensch“ eingereicht.
Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt der Stadt Hagen und unter aktiver Beteiligung von Menschen mit einer Behinderung sowie Studierenden der Fachhochschule Hagen soll im Rahmen eines Projektes die Verantwortung städtischer Institutionen während des Regimes aufgearbeitet werden. Das Ziel: Einen angemessenen Ort des Gedenkens schaffen, eine fortlaufende Information der Öffentlichkeit organisieren und pädagogische Konzepte erarbeiten.
Auch interessierte Hagenerinnen und Hagener sind herzlich zur Beteiligung an dem Projekt eingeladen. Am Dienstag, 20. Februar, um 15 Uhr erfolgt im Gesundheitsamt der Stadt Hagen, Berliner Platz 22, in Raum A.225 der offizielle Projektstart. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Friedrich Schmidt, Bereichsleiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Stadt Hagen, unter Telefon 02331/207-3554 sowie per E-Mail an friedrich.schmidt@stadt-hagen.de.
Hintergrund des Projektes
Bislang fehlt in Hagen eine angemessene Erinnerung an jenes Unrecht, das Menschen mit einer Behinderung während der nationalsozialistischen Diktatur erfahren haben. Hierzu gehören die behördlich verfügte Patiententötung (sogenannte Euthanasie), die Zwangssterilisation sowie die Zwangsabtreibung. Auch andere marginalisierte Gruppen wie Homosexuelle, Wohnungslose sowie Sinti und Roma wurden durch die Behörden verfolgt.
Mittlerweile ist das gesamte Ausmaß der genannten Gräueltaten geschichtswissenschaftlich erfasst und die Einzelfälle sind belegt. Da gerade in Hagen besonders viele Menschen mit einer Behinderung Opfer nationalsozialistisch motivierten staatlichen Unrechts geworden sind, besteht eine besondere Verpflichtung, diese Schuld einzugestehen und der Opfer würdig zu gedenken.
Städtische Einrichtungen mit in der Verantwortung
Die Hauptschuld an den aufgearbeiteten Taten trägt zu großen Teilen die damalige Gesundheitsverwaltung der Stadt Hagen. Ohne das Handeln der Fürsorgerinnen und der Ärzte, einschließlich der damaligen Leitung des Gesundheitsamtes Hagen, wäre es nicht möglich gewesen, so viele Menschen einer Sterilisation oder Patiententötung zuzuführen oder auszugrenzen.
1933 begann die erbbiologische Erfassung der gesamten Hagener Bevölkerung. Eine tragende Rolle in der Selektion sowie der Familienforschung – damals noch als Sippenforschung bezeichnet – trug das Gesundheitsamt. Es erfasste systematisch unter anderem Informationen über Erkrankungen, schlechte schulische Leistungen, Unfälle, Arbeitslosigkeit, psychische Störungen, Vorstrafen und das Sexualleben von Hagenerinnen und Hagenern. Hierfür wurden unter anderem große Archivräume beschafft, Mitarbeitende eingestellt sowie unzählige „Ermittlungen“ eingeleitet.
Aktenbestand dokumentiert Gräueltaten
Heute besitzt das Gesundheitsamt eine Liste mit fast 1.000 sogenannter „Erbgesundheitsakten“, bei denen es um Zwangssterilisationen ging. Der Aktenbestand des Erbgesundheitsgerichts von etwa 5.500 Einzelfallakten wird im Stadtarchiv aufbewahrt.
Bis heute haben die damals betroffenen Menschen sowie ihre Familien keine angemessene Entschuldigung beziehungsweise Anerkennung ihres unermesslichen Leides erfahren. Die Überlebenden der Zwangssterilisation litten ihr gesamtes Leben unter den körperlichen und psychischen Folgen, Anträge auf Entschädigungen wurden fast ausnahmslos abgelehnt.
Häufig waren die Ärzte in den Verfahren die gleichen Personen, die für die Sterilisation verantwortlich waren. Weder sie noch die Fürsorgerinnen wurden hierfür jemals zur Verantwortung gezogen. Sie durften oft sogar im Amt bleiben, erhielten für ihre Arbeit teilweise Auszeichnungen oder konnten ihre beruflichen Karrieren in anderen gesundheitlichen Tätigkeitsfeldern fortsetzen.
Im Rahmen der Aufarbeitung wurde 2018 das Buch „Vergessene Opfer. NS-Euthanasie in Hagen“ vorgestellt. 303 Hagener Bürger konnten als Opfer identifiziert werden. 2019 folgte „Vergessene NS-Opfer. Zwangssterilisationen in Hagen“, in dessen Zuge auch die Ausstellung „Behinderung im Wandel der Zeit“ stattfand.
Hauptakteure waren die FH Dortmund (mit dem Hagener Professor Dr. Michael Boecker), die Caritas (mit Meinhard Wirth) und das Rahel Varnhagen Kolleg (mit Pablo Arias Meneses).
Drucken, Mailen, Facebook, Twitter:
Gefällt mir Wird geladen …
 Nachdem der Kunstmäzen und Kulturreformer Karl Ernst Osthaus (1874-1921) 1902 sein privates Museum Folkwang in Hagen eingeweiht hatte, begründete er 1906 die Künstlerkolonie Hohenhagen.
Nachdem der Kunstmäzen und Kulturreformer Karl Ernst Osthaus (1874-1921) 1902 sein privates Museum Folkwang in Hagen eingeweiht hatte, begründete er 1906 die Künstlerkolonie Hohenhagen. Unmittelbare und bewegende Einblicke in die Alltagsgeschichte der NS-Zeit in Westfalen-Lippe eröffnet eine neue Filmdokumentation, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) unter dem Titel „Unterm Hakenkreuz. Westfalen 1933-1945 im Amateurfilm“ produziert hat (Foto: LWL).
Unmittelbare und bewegende Einblicke in die Alltagsgeschichte der NS-Zeit in Westfalen-Lippe eröffnet eine neue Filmdokumentation, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) unter dem Titel „Unterm Hakenkreuz. Westfalen 1933-1945 im Amateurfilm“ produziert hat (Foto: LWL). Alexander Schlüter (links) mit seinen Töchtern und weiteren Verwandten ca. 1937. Foto: privat.
Alexander Schlüter (links) mit seinen Töchtern und weiteren Verwandten ca. 1937. Foto: privat. Ausschnitt aus der Serbeurkunde Maximilian Sander. Quelle: Arolsen archives, Dokument Nr. 3474377#1.
Ausschnitt aus der Serbeurkunde Maximilian Sander. Quelle: Arolsen archives, Dokument Nr. 3474377#1. Ein eigenes kleines Haus mit Nutzgarten – um 1907 sollte das für die Hagener Textilarbeiter kein Traum bleiben müssen. Karl Ernst Osthaus holte 1905 die Teilnehmer einer Konferenz für „Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen“ nach Hagen. In der Folge konnte er dem in München geborenen Künstler-Architekten Richard Riemerschmid einen Bauauftrag durch Elbers in Hagen verschaffen.
Ein eigenes kleines Haus mit Nutzgarten – um 1907 sollte das für die Hagener Textilarbeiter kein Traum bleiben müssen. Karl Ernst Osthaus holte 1905 die Teilnehmer einer Konferenz für „Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen“ nach Hagen. In der Folge konnte er dem in München geborenen Künstler-Architekten Richard Riemerschmid einen Bauauftrag durch Elbers in Hagen verschaffen. Haus Harkorten ist ein architekturgeschichtliches Juwel, das lange vernachlässigt worden ist. Vor einigen Monaten hat endlich die Restaurierung des Daches beginnen können, in diesem Jahr soll die Renovierung der Fassaden in Angriff genommen werden (Foto: Michael Eckhoff). Die Arbeiten im Inneren des wertvollen, bereits 1756 gebauten Fachwerkbauwerks lassen jedoch noch lange auf sich warten.
Haus Harkorten ist ein architekturgeschichtliches Juwel, das lange vernachlässigt worden ist. Vor einigen Monaten hat endlich die Restaurierung des Daches beginnen können, in diesem Jahr soll die Renovierung der Fassaden in Angriff genommen werden (Foto: Michael Eckhoff). Die Arbeiten im Inneren des wertvollen, bereits 1756 gebauten Fachwerkbauwerks lassen jedoch noch lange auf sich warten. Nach Christian Dahlenkamp ist eine Straße benannt, genauso wie nach Heinrich Willde. Willi Cuno ist neben einer Straße sogar in der Cuno-Siedlung verewigt worden. Es waren allesamt Hagener Bürger- bzw. Oberbürgermeister – genauso wie Cuno Raabe. Aber der ist aus dem Bewusstsein der Stadt verschwunden (Foto: Nach der Haft 1945, © Deutsches Historisches Museum).
Nach Christian Dahlenkamp ist eine Straße benannt, genauso wie nach Heinrich Willde. Willi Cuno ist neben einer Straße sogar in der Cuno-Siedlung verewigt worden. Es waren allesamt Hagener Bürger- bzw. Oberbürgermeister – genauso wie Cuno Raabe. Aber der ist aus dem Bewusstsein der Stadt verschwunden (Foto: Nach der Haft 1945, © Deutsches Historisches Museum). Zu einer Führung durch die Liebfrauenkirche, Liebfrauenstraße 23, lädt die Volkshochschule Hagen (VHS) am Dienstag, 9. April, von 17 bis 18.30 Uhr ein.
Zu einer Führung durch die Liebfrauenkirche, Liebfrauenstraße 23, lädt die Volkshochschule Hagen (VHS) am Dienstag, 9. April, von 17 bis 18.30 Uhr ein. Angesichts der Tatsache, dass die Bevölkerung aus Kreisen der Politik wieder an mögliche Waffengänge gewöhnt werden soll, ist es nicht die schlechteste Idee, sich die Folgen zu vergegenwärtigen.
Angesichts der Tatsache, dass die Bevölkerung aus Kreisen der Politik wieder an mögliche Waffengänge gewöhnt werden soll, ist es nicht die schlechteste Idee, sich die Folgen zu vergegenwärtigen. Der Pavillon gegenüber dem Hohenlimburger Rathaus steht jetzt unter Denkmalschutz (Foto:
Der Pavillon gegenüber dem Hohenlimburger Rathaus steht jetzt unter Denkmalschutz (Foto: 
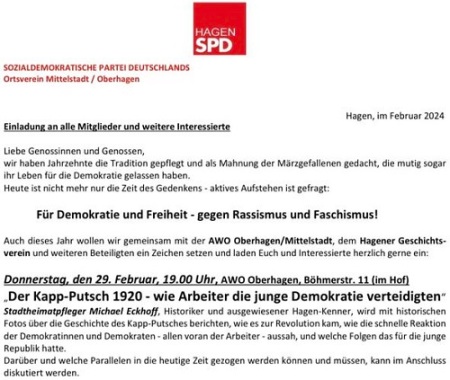
 Hagener Rathaus von 1903. Zeitgenössische Postkarte, um 1925.
Hagener Rathaus von 1903. Zeitgenössische Postkarte, um 1925. Früheres Viktoria-Kino in der Mittelstraße. Foto: Viktoria Franz-Gröl.
Früheres Viktoria-Kino in der Mittelstraße. Foto: Viktoria Franz-Gröl. „Empfehlungsschreiben“ (Ausschnitt) des damaligen FDP-Landtagsabgeordneten und späteren NRW-Innenministers Willi Weyer (
„Empfehlungsschreiben“ (Ausschnitt) des damaligen FDP-Landtagsabgeordneten und späteren NRW-Innenministers Willi Weyer ( Titelseite der Hagener Zeitung, 4. Oktober 1911 (Ausschnitt)
Titelseite der Hagener Zeitung, 4. Oktober 1911 (Ausschnitt)



